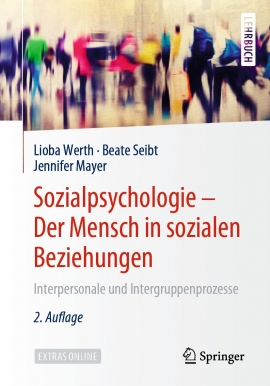1 Beziehungen
2 Sozialer Einfluss
3 Prozesse in Kleingruppen – Intragruppenprozesse
4 Vorurteile
5 Aggressives Verhalten
6 Prosoziales Verhalten – Wann und warum wir anderen helfen
Für das vorliegende Buch haben wir Teil II des einbändigen Werks Sozialpsychologie (Werth und Mayer 2006) erweitert und aktualisiert. Kap. 1 ist neu hinzugekommen, und die anderen Kapitel wurden um neue Themen und Befunde ergänzt. In Exkursen und Illustrationen skizzieren wir außerdem, wie die besprochenen Prozesse ein Licht auf aktuelle politische und gesellschaftliche Fragen werfen. Teil I des Werks erscheint unter dem Titel Sozialpsychologie – Das Individuum im sozialen Kontext: Wahrnehmen – Denken – Fühlen (Werth et al. 2020).
1 Beziehungen
Wann haben Sie sich zuletzt verliebt? Wie häufig hatten Sie schon Liebeskummer? Hand aufs Herz: Über wen haben Sie sich in den vergangenen Wochen am meisten aufgeregt, über Ihren Freund/Ihre Freundin, einen Mitbewohner oder Ihre Eltern? Oder auch einen Dozenten, einen Sporttrainer oder einen Kommilitonen? Ob Liebes-, Arbeits-, Wohnbeziehung – soziale Beziehungen bestimmen unseren Alltag. Denn wir verbringen ihn mit Menschen, mit denen uns, ob gewollt oder nicht gewollt, Beziehungen verbinden: Wir haben Freunde, Verwandte, Vorgesetzte, Partner, manchmal auch Geliebte und zuweilen auch ein paar Feinde. In diesem Kapitel erfahren Sie, was Beziehungen unterschiedlicher Art aus sozialpsychologischer Sicht charakterisiert und welche Bedeutung Beziehungen für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit haben (Abschn. 1.1). Anschließend lesen Sie, welche Faktoren die Aufnahme einer Beziehung wahrscheinlicher machen (Abschn. 1.2). Sie lernen darüber hinaus die sozialpsychologische Sicht auf die Thematik „Liebe“ kennen sowie typische Verläufe von Paarbeziehungen, Forschung zum Umgang mit Krisen in der Partnerschaft und zu Auswirkungen von Trennungen (Abschn. 1.3).
2 Sozialer Einfluss
Dieses Kapitel widmet sich den Mechanismen sozialen Einflusses, d. h., wie wir durch andere Menschen in unserem Denken und Handeln beeinflusst werden. Sozialer Einfluss liegt bereits vor, wenn sich allein durch die Anwesenheit anderer Personen unser Leistungsverhalten verändert, auch wenn jene uns gar nicht absichtlich beeinflussen wollen. Dies wird unter den Stichworten „soziale Erleichterung“ und „soziale Hemmung“ dargestellt. Ob andere Personen eine Mehr- oder Minderheitsmeinung uns gegenüber vertreten, wirkt ebenfalls als sozialer Einfluss (eine direkte Beeinflussungsabsicht kann, muss hier aber nicht vorliegen) und wird im Anschluss besprochen. Im letzten Teil des Kapitels geht es um den klassischen Fall sozialen Einflusses, den absichtlichen, taktisch klug eingefädelten Beeinflussungsversuch.
3 Prozesse in Kleingruppen – Intragruppenprozesse
Wenn wir davon ausgehen, dass „zwei Köpfe mehr wissen als einer“, dann sollten Gruppen auch bessere Entscheidungen fällen als eine einzelne Person. Wie aber kommt es dann immer wieder zu so katastrophalen Entscheidungen wie beispielsweise der Entscheidung der Beratergruppe um Kennedy für die Invasion der Schweinebucht auf Kuba im Jahre 1961? Dieses Beispiel zeigt schon, dass es im Falle von Gruppen um eine besondere Art von sozialer Situation geht. So weisen Gruppen Merkmale auf, die zusätzliche Arten sozialen Einflusses bedingen oder die Stärke des sozialen Einflusses moderieren. Um diese aufzuzeigen, wird zunächst dargestellt, was mit der Bezeichnung „Gruppe“ genau gemeint ist. Weiterhin beschäftigt sich dieses Kapitel damit, wie sich die soziale Situation Gruppe auf das Leistungsverhalten auswirkt, und schließlich wird es um Besonderheiten des Entscheidungsprozesses in Gruppen gehen.
4 Vorurteile
Warum ist der Begriff „Vorurteil“ in unseren Köpfen so negativ behaftet? Dies liegt daran, dass Vorurteile neben positiven Effekten auf die Effizienz der Informationsverarbeitung auch verheerende Auswirkungen haben können und uns vor allem diese negative Seite der Medaille präsent ist. So können Vorurteile dazu führen, dass beispielsweise Ausländer, Behinderte oder auch Übergewichtige sowohl in der Schule als auch im Berufsleben gehänselt, drangsaliert und gemieden werden. Aufgrund dieser Auswirkungen von Vorurteilen und ihrer Eskalationen erscheint es besonders bedeutsam, Kenntnis darüber zu haben, was Vorurteile genau sind (Abschn. 4.1), wann und wie sie zur Anwendung kommen (Abschn. 4.2), wie sie entstehen (Abschn. 4.3) und was sie aufrechterhält (Abschn. 4.4). Auf Basis dieses Wissens ist es möglich, verantwortungsvoller mit eigenen Vorurteilen umzugehen.
5 Aggressives Verhalten
In diesem Kapitel geht es zunächst um die biologischen und kulturellen Grundlagen aggressiven Verhaltens (Abschn. 5.1). In Abschn. 5.2 werden die Rolle von Gefühlen, insbesondere von Ärger und Frustration, aber auch von negativem Affekt allgemein für die Auslösung und Intensivierung aggressiven Verhaltens beschrieben. Um das Erlernen aggressiver Verhaltensschemata sowie die Sozialisierung in die gruppenspezifischen aggressionsbezogenen Normen geht es in Abschn. 5.3. In Abschn. 5.4 werden wichtige situative Einflussfaktoren auf aggressives Verhalten aufgezeigt und in Abschn. 5.5 wird – aufgrund der zunehmenden Relevanz – der Einfluss der Medien auf aggressives Verhalten gesondert behandelt.
6 Prosoziales Verhalten – Wann und warum wir anderen helfen
Im Jahr 1997 wurde in Hamburg ein 17-jähriges Mädchen in der S-Bahn vergewaltigt. Das Opfer rief um Hilfe, aber keiner der anderen Fahrgäste griff ein oder rief die Polizei. Angesichts solcher Vorfälle sind wir entsetzt, nicht nur ob der Grausamkeit der Verbrechen an sich, sondern insbesondere deshalb, weil die Zeugen – obwohl sie gekonnt hätten – den Opfern nicht zu Hilfe kamen. Warum haben sie es nicht getan? Waren die Zeugen alle Egoisten, die sich nicht für ihre Umwelt interessierten? Wie sich gezeigt hat, ist dies nicht der Fall, sondern es sind insbesondere situative Faktoren bedeutsam dafür, ob Menschen helfen oder nicht (Abschn. 6.1). Unsere Bestürzung angesichts unterlassener Hilfeleistung spiegelt wider, dass wir grundsätzlich erwarten, dass Menschen anderen helfen, die ihrer Hilfe bedürfen. Weshalb? Liegt prosoziales Verhalten in der Natur des Menschen? Welche Motive für prosoziales Verhalten gibt es? Diesen Fragen ist Abschn. 6.2 gewidmet.