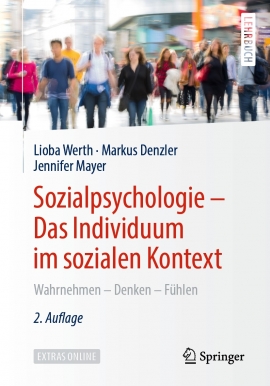1 Einführung in die Sozialpsychologie
2 Soziale Kognition: Grundlagen sozialer Informationsverarbeitung und sozialen Verhaltens
3 Heuristiken
4 Denken und Fühlen
5 Soziale Wahrnehmung
6 Das Selbst
7 Einstellungen
1 Einführung in die Sozialpsychologie
Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Sozialpsychologie, indem erklärt wird, was die Sozialpsychologie ist, warum sie nicht das Gleiche ist wie Laienpsychologie und wie sie sich von benachbarten Disziplinen abgrenzen lässt. Im Anschluss daran werden im Überblick methodische Grundlagen der Sozialpsychologie dargestellt: Die Korrelationsmethode und das Experiment werden erklärt, und die statistische Absicherung von empirischen Ergebnissen wird beschrieben. Ebenso wird auf Kritik an der Experimentalmethodik sowie auf die Replizierbarkeit sozialpsychologischer Forschungsergebnisse eingegangen. Am Ende dieses Kapitels wird ein Überblick über den vorliegenden Band (Das Individuum im sozialen Kontext) sowie über ▶ Sozialpsychologie II (Der Mensch in sozialen Beziehungen) gegeben.
2 Soziale Kognition: Grundlagen sozialer Informationsverarbeitung und sozialen Verhaltens
In diesem Kapitel wird zunächst die soziale Kognition als Informationsverarbeitung im sozialen Kontext eingeführt. Forschungsgegenstand der sozialen Kognition ist, wie sozial relevante Informationen wahrgenommen, abgespeichert (enkodiert), organisiert und abgerufen werden, wie sie Prozesse des Urteilens und der Entscheidungsfindung in sozialen Situationen beeinflussen. Die Informationsverarbeitung als Ausgangspunkt auch von sozialem Verhalten spielt eine zentrale Rolle bei den meisten weiteren Themen, die in diesem Buch behandelt werden. Am Ende dieses Kapitels wird deshalb darauf eingegangen, wie menschliches Verhalten aus dem Zusammenspiel impulsiver, automatischer sowie kontrollierter, deliberativer Prozesse entsteht.
3 Heuristiken
In diesem Kapitel werden drei zentrale Urteilsheuristiken vorgestellt. Heuristiken sind einfache Faustregeln, anhand derer Menschen in kurzer Zeit relativ komplexe Entscheidungen treffen können – und das meist hinreichend genau. Allerdings können sie auch zu systematischen Urteilsverzerrungen führen. Es wird zunächst auf die Repräsentativitätsheuristik eingegangen, bei der Urteile aufgrund der Repräsentativität eines Urteilgegenstands beispielsweise für eine Kategorie getroffen werden. Im Anschluss wird die Verfügbarkeitsheuristik eingeführt. Bei dieser wird insbesondere die Empfindung von Leichtigkeit beim Informationsabruf als Grundlage für Urteile genutzt. Zum Abschluss wird die Ankerheuristik besprochen, bei der ein Urteil an einen Ausgangswert angeglichen wird. Fehleinschätzungen, wie sie aufgrund des Gebrauchs von Heuristiken auftreten können, geben Aufschlüsse darüber, wie Menschen mit begrenzten kognitiven Ressourcen in einer komplexen Welt Entscheidungen treffen.
4 Denken und Fühlen
In diesem Kapitel wird dargestellt, wie sich unser affektives Erleben und unser Denken (z. B. Informationsverarbeitung und Urteilsbildung) wechselseitig beeinflussen. Zunächst wird beschrieben, wie sich der Informationsverarbeitungsstil in Abhängigkeit von der jeweiligen Stimmung unterscheiden kann: Zum einen werden bei Wahrnehmung und Erinnerung stimmungskongruente Informationen besser verarbeitet. Darüber hinaus können von der Stimmung gefärbte Urteile auch entstehen, indem die Stimmung selbst als Information über den Urteilsgegenstand herangezogen wird. Des Weiteren wird in dem Kapitel dargelegt, welchen Einfluss Kognitionen auf die Entstehung und die Veränderung unseres affektiven Erlebens haben. So hängt das Entstehen spezifischer Emotionen stark von der Bewertung der emotionsauslösenden Situation ab. Darüber hinaus können weitgehend ohne die Beteiligung von Kognitionen Affekte durch Wahrnehmung und Imitation ausgelöst werden.
5 Soziale Wahrnehmung
In diesem Kapitel wird dargelegt, wie Personen zu einem Eindruck und einer Beurteilung einer anderen Person kommen. Dabei wird auf die Rolle von äußerlich beobachtbaren Merkmalen des zu Beurteilenden und des Verhaltens einer Person eingegangen. Fehleinschätzungen resultieren häufig daraus, dass bei der Beurteilung von Verhalten situative Gegebenheiten zu wenig berücksichtigt und damit letztendlich dispositionale Faktoren überschätzt werden. Es wird zudem auf Merkmale der Situation bei der Eindrucksbildung eingegangen. Je nach Blickwinkel und Auffälligkeit können Beurteilungen ein und desselben Verhaltens sehr unterschiedlich ausfallen. Schließlich werden auch Merkmale des Beurteilers dargelegt, die einen Einfluss auf die Eindrucksbildung ausüben. Auch aufgrund dieser Merkmale ist die Beurteilung anderer Personen meist nicht das, was wir „objektiv“ nennen würden. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, verzerrende Mechanismen zu kennen und sie bei weitreichenden Beurteilungen zu vermindern.
6 Das Selbst
In diesem Kapitel wird zunächst auf das Selbstkonzept, das aus multiplen Selbstaspekten besteht, und die Wege der Aktivierung von Teilen des Selbstkonzepts eingegangen. Anschließend werden die Funktionen des Selbst, hier vor allem die strukturierende, die motivational-emotionale und die handlungsregulierende Funktion, beschrieben. Des Weiteren werden Wege der Selbsterkenntnis (Introspektion, Selbstbeobachtung und Vergleich mit anderen Personen) erklärt. Das Kapitel endet mit einer Darlegung von Strategien, die vor allem bei der Bedrohung des Selbst eingesetzt werden, um ein positives Selbstbild aufrechtzuerhalten (Selbstwertbestätigung, selbstwertdienliche soziale Vergleiche und selbstwertdienliche Attributionen).
7 Einstellungen
Nach einer Definition des Konstrukts Einstellung wird auf die kognitive und motivationale Funktion von Einstellungen eingegangen. Danach schließen sich Abschnitte zur Einstellungsbildung (genetische Faktoren, Lernprozesse, Selbstwahrnehmungsprozesse und Mere Exposure) und Einstellungsänderung an. In letzterem wird vor allem auf das Streben nach Konsistenz bzw. kognitiver Dissonanz, Strategien zur Reduktion von Dissonanz und auf Persuasion, d. h. die bewusste Einflussnahme, um Einstellungen zu ändern, eingegangen. Anschließend werden Wege vorgestellt, wie Resistenz gegenüber Einstellungsänderungen aufgebaut werden kann. Das Kapitel endet mit einem Abschnitt zum Zusammenhang von Einstellungen und Verhalten sowie einem Überblick über direkte und indirekte Messmethoden für Einstellungen.